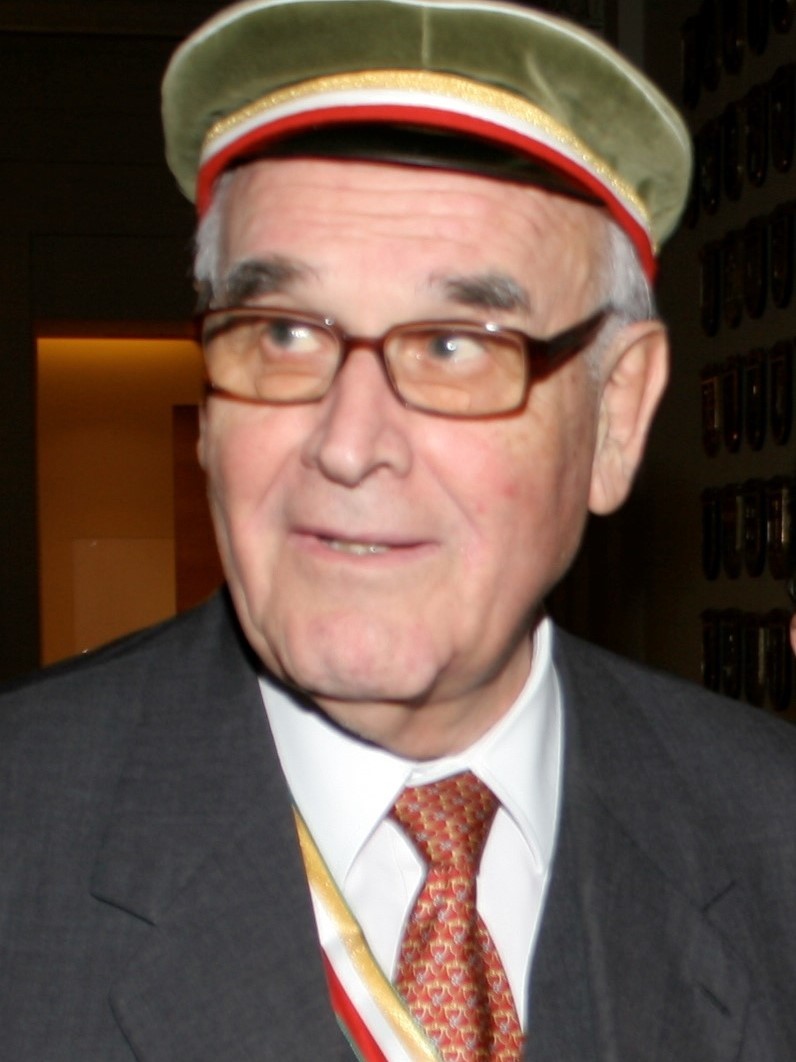Lebenslauf:
AUSBILDUNG UND WISSENSCHAFTLICHE LAUFBAHN
Schambeck wurde als Sohn eines Unternehmers geboren und wuchs in gut situierten Verhältnissen in Baden bei Wien auf, wo er auch das Gymnasium besucht hatte. Nach seiner Matura im Jahr 1953 begann er das Studium an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (Dr. iur. 1958), wo er der Rudolfina beitrat (Couleurname Seneca), deren Consenior er im Sommersemester 1958 war. Sein Leibbursch war der spätere Militärbischof Alfred Kostelecky (Rd). Nach dem Studienende absolvierte er 1958/59 das Gerichtsjahr beim Bezirksgericht Baden bei Wien und beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.
Danach begann Schambeck eine wissenschaftliche Laufbahn im Fach Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie und wurde 1959 Assistent bei Adolf Merkl, der 1961 emeritiert wurde, aber noch weitere vier Jahre lehrte, und ein Schüler von Hans Kelsen war. 1964 habilitierte sich Schambeck für Allgemeine Staatslehre, Rechtsphilosophie und Verfassungsrecht. 1965 wurde er Rechtskonsulent in der wissenschaftlichen Abteilung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft.
Im April 1966 wurde der Innsbrucker Verfassungsrechtler Hans Klecatsky zum Justizminister berufen und deshalb als Professor freigestellt. Um die dadurch entstandene Lücke auszugleichen, wurde Schambeck 1966 zum außerordentlichen Professor für Politologie, Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck ernannt. 1967 war er Gastprofessor an der University of Notre Dame in South Bend (Indiana, USA).
In Innsbruck blieb jedoch Schambeck nicht lange, denn 1966 eröffnete in Linz die Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, an der auch das Studium der Rechtswissenschaften angeboten wurde (1974 eine eigene Fakultät, 1975 wurde die Hochschule in Johannes Kepler Universität unbenannt). 1967 wurde er zum ordentlichen Professor für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Politische Wissenschaften berufen. 2002 wurde er emeritiert.
Anfänglich war Schambeck Schüler des Rechtspositivisten Adolf Merkl, wandte sich aber bald der naturrechtlich-universalistischen Völkerrechtsschule von Alfred Verdroß zu, auf dessen Empfehlung Schambeck Mitte der sechziger Jahre kurze Zeit beim Völkerrechtler Stephan Verosta Assistent war. Viele seiner Veröffentlichungen behandeln grundlegende Fragen zu Staat und Recht im Kontext der europäischen Integration aus rechtsphilosophier bzw. naturrechtlicher Perspektive. Viele seiner Schriften gehen auf die Katholische Soziallehre, das Rechtsverständnis der katholischen Kirche und deren Bedeutung für die Lehre der Formen der politischen Organisation ein.
Schambeck gab zahlreiche Sammelbände und Festschriften heraus. Letztere organisierte er vornehmlich für seinen unmittelbaren Freundeskreis, wie u. a. für Fritz Eckert (Am EM), Alfred Kostelecky (Rd), Hans-Walther Kaluza (Walth). Ihm wurden auch zahlreiche Ehrendoktorate verliehen, u. a. der Universitäten Prag, Breslau, Kiew, Santiago de Chile und Washington (Catholic University). Darüber hinaus war er Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Akademien und Gesellschaften
POLITISCHE LAUFBAHN
Schambeck engagierte sich neben seiner wissenschaftlichen Laufbahn auch politisch im ÖAAB und in der ÖVP. 1962 wurde er Referent für Kulturpolitik bei der Bundesleitung des ÖAAB, 1966 Referent für Rechtspolitik sowie für Kultur und Bildung. Seine politische Heimat war Niederösterreich bzw. Baden. Nach den dortigen Landtagswahlen im Oktober 1969 wurde er vom niederösterreichischen Landtag zum Mitglied des Bundesrates gewählt. Dieses Mandat übte er nach mehrmaligen Wiederwahlen vom 20. November 1969 bis zu dessen Niederlegung am 30. Juni 1997 aus. Das waren fast 28 Jahre. Er ist somit das längstdienende Bundesratsmitglied in der Geschichte Österreichs.
Am 27. November 1975 wurde Schambeck als Nachfolger von Johann Gassner (Rt-D EM) zum Ständigen stellvertretenden Vorsitzenden (hieß ab 1. Juli 1988 Vizepräsident) des Bundesrates gewählt und in der Folge in dieser Funktion mehrmals wiedergewählt. Mit dieser war auch der Vorsitz in der ÖVP-Bundesratsfraktion und die Mitgliedschaft im Präsidium des Klubs der Nationalratsabgeordneten und Mitglieder des Bundesrates der ÖVP verbunden. Auch wenn der Bundesrat in Österreich verfassungsrechtlich eine dem Nationalrat nachgeordnete Stellung einnimmt, besaß Schambeck eine wichtige Funktion im Rahmen der parlamentarischen Arbeit der ÖVP. Er war fast 22 Jahre Vizepräsident (bzw. Präsident). Sein Vorvorgänger in diesem Amt Fritz Eckert (Am EM) war das mehr als 16 Jahre.
Die Vorsitzenden bzw. Präsidenten des Bundesrates wechseln halbjährlich in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländer. Als das Land Niederösterreich den Vorsitzenden bzw. den Präsidenten zu stellen hatte, übte Schambeck diese Funktion vom 1. Januar 1988 bis zum 30. Juni 1988, vom 1. Juli 1992 bis zum 31. Dezember 1992 und vom 1. Januar 1997 bis zum 30. Juni 1997 aus. Während dieser Funktionen war jemand anderer zeitweise Ständiger stellvertretender Vorsitzender bzw. Vizepräsident des Bundesrates. Den Vorsitz in der Bundesversammlung (gemeinsame Sitzung von National- und Bundesrat) üben alternierend die Präsidenten des Nationalrates und des Bundesrates aus. Am 8. Juli 1992 wurde Thomas Klestil (Baj) vor der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten angelobt. Den Vorsitz führte damals Schambeck.
Protokollarisch rangiert der Präsident des Bundesrates zwischen den Bundesministern und den Präsidenten der Höchstgerichte, der Vizepräsident des Bundesrates zwischen den Staatssekretären und den Bundesministern a. D. Hingegen erhalten die Mitglieder des Bundesrates 50 Prozent und der Vizepräsident des Bundesrates 70 Prozent des Bezuge eines Nationalratsabgeordneten. Der Präsident des Bundesrates ist bezügemäßig dem Nationalratsabgeordneten gleichgestellt.
Schambeck übte auch zahlreiche parteipolitische Funktionen aus. So gehörte er seit 1966 der Landesleitung des niederösterreichischen ÖAAB an und war von 1972 bis 1989 Hauptbezirksparteiobmann der ÖVP für den Bezirk Baden. Seit 1975 gehörte er dem Bundesvorstand der Fraktion Christlicher Gewerkschafter sowie der ÖVP- Bundesparteileitung und der niederösterreichischen ÖVP-Landesparteileitung der ÖVP an.
Ebenso war er Mitglied des ÖAAB-Bundesvorstandes. 1982 wurde er zum Föderalismussprecher der ÖVP bestellt. Seit 1977 war er als Nachfolger von Rudolf Gruber (NdW) viele Jahre Präsident der Österreichisch-Deutschen Kulturgesellschaft.
ENGAGEMENT FÜR DIE KIRCHE
Schambeck engagierte sich auch in bzw. für die katholische Kirche und nahm für sie bzw. in ihr zahlreiche Funktionen wahr. So war er nach seinen Angaben auf Vorschlag des damaligen Nuntius Opilio Kardinal Rossi (Dan EM) von 1967 bis 1997 Delegierter des Heiligen Stuhls bei der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Von 1993 bis 2009 war er Konsultor des Päpstlichen Rates für die Familie. Er war Gründungsmitglied der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften, der er seit 1994 als ordentliches Mitglied und seit 2019 als Ehrenmitglied angehörte. Der Heilige Stuhl ehrte ihn mit dem Großkreuz des Gregoriusordens, und Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 1990 zum „Gentiluomo di Sua Santita“ (Kämmerer Seiner Heiligkeit). Darüber hinaus war er Mitglied der Erzbruderschaft am Campo Santo bei St. Peter in Rom. Wäre er in Rom verstorben, hätte er das Recht gehabt, auf diesem Friedhof begraben zu werden.
Durch seine Vertretungsfunktion bei der IAEA ab 1967 kam Schambeck zwangsläufig in nähere Verbindung mit dem jeweiligen Nuntius in Wien und mit römischen Zentralstellen. Er vermittelte in Österreich den Eindruck, durch seine Kontakte intime Kenntnisse über den Heiligen Stuhl zu besitzen und gelegentliche Eiflußnahmen ausüben sowie päpstliche Ordensverleihungen und Papstaudienzen arrangieren zu können. So verbreitete er 1977 das Gerücht, die Ernennung von Alfred Kostelecky (Rd) zum Weihbischof von Wien stünde unmittelbar bevor. Tatsächlich wurden aber Helmut Krätzl und Florian Kuntner (Ne) zu solchen ernannt.
Schambeck zählte zweifelsohne zum konservativen Flügel des österreichischen Katholizismus, stand allerdings eindeutig auf dem Boden des II. Vatikanums. Ihm wurde hingegen u. a. unterstellt, bei der Frage der Nachfolge von Franz Kardinal König (Rd EM) die Weichen in Richtung Hans-Hermann Groër und Kurt Krenn gestellt zu haben, was er freilich immer vehement bestritten hat. Man würde ihn sicherlich überschätzen, wenn er tatsächlich eine konkrete Einflußnahme besessen hätte. Daß er in Rom seine Sicht auf die österreichische Kirche hinter den Berg gehalten hat, wird aber auch nicht zutreffen.
Zweifellos hatte Schambeck einen freundschaftlichen Kontakt mit dem seinerzeitigen Kardinalstaatssekretär Agostino Casaroli, dessen Reden und Aufsätze er in Deutsch herausbrachte. Auch mit dem Präfekten der Glaubenskongregation Joseph Ratzinger (Rup EM) stand er in Kontakt. An der Anbahnung seines Besuches als Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007 in Österreich soll er beteiligt gewesen sein.
ENGAGEMENT IM ÖCV
Schambeck, gerade promoviert und junger Assistent, kandidierte auf der Cartellversammlung 1959 als Nachfolger von Alfred Twaroch (Alp) für das Amt für Bildungswesen im ÖCV. Sein Gegenkandidat war der spätere Professor für Wirtschaftsverwaltungsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien Karl Wenger (Kb). Bei der Wahl entfielen auf Schambeck 57 und auf Wenger 11 Stimmen. Schambeck gewann deutlich mit fast 84 Prozent. Er war der vierte Amtsträger für Bildungswesen seit Gründung des ÖCV 1933. Als solcher war er Mitglied des ÖCV-Beirates, der später in die Verbandsführung aufgegangen ist.
Die damalige Bildungsarbeit des ÖCV war nicht mit der nunmehrigen (Bildungsakademie) vergleichbar. 1949 wurde eine jährliche Schulungswoche im Herbst eingeführt, die der Bildungsamtsträger gemeinsam mit dem Vorort zu organisieren hatte. Die für die Bildungsarbeit im ÖCV zur Verfügung stehenden Mittel waren vergleichsweise gering. Schambeck organisierte solche Schulungswochen, wobei er aufgrund seines akademischen Berufes bei der Auswahl der Referenten auf Qualität achten konnte. Zusätzlich organisierte er Vorträge im Festsaal des ÖCV-Hauses und im Auditorium maximum der Wiener Universität.
Bald nach Beginn seiner Amtszeit initiierte Schambeck die Schriftenreihe „Ruf und Antwort“, die vom ÖCV gemeinsam mit dem deutschen CV und dem Schweizerischen Studentenverein (StV) herausgegeben wurde. Mitherausgeber für den deutschen CV war der spätere Intendant des Bayerischen Rundfunks Albert Scharf (Ae). In Zusammenarbeit mit der Wiener Niederlassung des Verlages Herder Freiburg/br. wurden in dieser Reihe sieben Bände herausgebracht.
Deren Autoren waren damals durchaus anerkannt, nämlich (in der Reihenfolge der Erscheinung) der Wiener Philosoph Leo Gabriel (NdW) („Mensch und Welt in der Entscheidung“), der international renommierte katholischen Sozialethiker Johannes Messner („Moderne Soziologie und scholastisches Naturrecht“), der Grazer Byzantinist Endre von Ivanka („Seit 900 Jahren getrennte Christenheit“), der deutsch-schweizer Theologe Otto Karrer („Das Erbe der Reformation in katholischer Sicht“), der deutsche Politiker (Mitglied des Bundestages, CDU-Bundesschatzmeister) Fritz Burgbacher (H-Na) („Bekenntnis zu Europa“), der Schweizer Verfassungsjurist und Politiker (Freisinnige-Demokratische Partei) Max Imboden („Gedanken und Gestalt des demokratischen Rechtsstaates“) und der ehemalige Unterrichtsminister Heinrich Drimmel (NdW) /(„Die Hochschule zwischen Gestern und Morgen“).
Die Qualität dieser Reihe stand außer Zweifel, doch vermittelte sie eher den Geist der fünfziger Jahre als den des Aufbruchs der sechziger Jahre. Sie war auch nicht für ein breiteres Käuferpublikum, auch im ÖCV, geeignet, Dafür sorgte auch schon die etwas einfallslose äußere Aufmachung. Bis weit in die siebziger Jahre hinein befanden sich größere Mengen dieser Bände im ÖCV-Sekretariat (wo diese Reihe scherzeshalber „Ruf ohne Antwort“ genannt wurde).
Drimmels Band erschien 1966 und war der letzte dieser Reihe. Er kam zwei Jahre nach seinem Rücktritt als Unterrichtsminister heraus und in einer Zeit, als im ÖCV bereits die Hochschulreformer, vor allem in der Austria Wien und in der Norica, Konzepte für eine Reform der Universitäten entworfen hatten. Drimmels Band war gewissermaßen ein Gegenbild der sich bereits abzeichnenden Entwicklungen. Es war daher kein Wunder, daß über Schambeck Ende 1966 in der Nummer 3 des 1. Jahrgangs der vom Wahlblock (CV-nahe Studentenpartei) herausgegebenen Zeitung „top public“ ein Artikel von Werner Vogt (ehemals AW) mit dem Titel „U-Minister Herbert Schambeck“ erschienen ist. Darin wurden verschiedene biographische Details von ihm kritisch unter die Lupe genommen, etwa seine akademische Laufbahn, weil er damals als möglicher Unterrichtsminister gehandelt wurde.
Dieser Beitrag hat damals im ÖCV größtenteils Empörung hervorgerufen. Er wurde auch Gegenstand der Erörterung innerhalb der ÖCV-Gremien. Der damalige Vorort Danubia (VOP Johannes M. Martinek) drückte sein Befremden aus, und die Verbandsführung stellte fest, daß das Prinzip Amicitia verletzt wurde, und beschloß einen Antrag auf Vorerhebungen gegen Vogt beim Landesehrengericht Wien. Diese Vorgangsweise weckte wiederum den Widerspruch im ÖCV-Beirat. Der Hochschulamtsträger Gernot Schaffer (Dan) bemängelte, daß er vorher nicht kontaktiert wurde, und war der Meinung, daß Schambeck sich selber wehren könne. Auch der Amtsträger für Information Kurt Bergmann (Dan) und der Leiter des Academia-Amtes Heribert Steinbauer (AW) kritisierten diesen Beschluß. Schambeck wurde hingegen vom Vorsitzenden der Verbandsführung Eduard Chaloupka (Baj) unterstützt. Zwischen diesen beiden herrschte ein enges Vertrauensverhältnis.
Schambeck hatte sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit auch um ein neues ÖCV-Bundeslied bemüht. Peter Diem (Rd) begann 1960 in der „Academia“ eine Debatte um dieses. Er bezeichnete den bisherigen Text „Einer Farbe, einem Glauben“ als „das gedankenloseste Provisorium, das in katholisch-österreichischen Kreisen je errichtet wurde“. Daraufhin gab es ein breites Echo, und zahlreiche Vorschläge wurden eingereicht. Aus diesen wählte Schambeck zwölf aus und stellte sie anonym in der „Academia“ zur Abstimmung. Von den rund 500 Antworten entfiel ca. die Hälfte auf den Textvorschlag „Auf des Glaubens Felsengrunde“ von Diem, der dann auf der Cartellversammlung 1960 beschlossen wurde.
Da nun Schambecks akademische Karriere als Professor in Linz begonnen hatte und sich seine politische Karriere (1969 Mitglied des Bundesrates) abzuzeichnen begann, verzichtete er 1967 auf eine neue Kandidatur als Amtsträger für Bildungswesen. Die Wahl seines Nachfolgers Maximilian Liebmann (Cl) sollte sich als Paradigmenwechsel im Bereich der Bildungsarbeit im ÖCV herausstellen.
EHRUNGEN
Schambeck organisierte für viele die Verleihung von Auszeichnungen (Orden) der Republik Österreich und des Heiligen Stuhls. Dabei legte er mitunter eine Insistenz an den Tag, die die betreffende Beamtenschaft über Gebühr inkommodierte. Aber er genoß es sichtlich, wenn auch ihm solche Auszeichnungen verliehen wurden. Nach einer Aufstellung waren es insgesamt 17 Großkreuze (Orden mit Stern und Schulterband), die ihm verliehen wurden. Er gehörte zum Kreis jener österreichischen Politiker mit den meisten solcher Orden.
Daneben erhielt Schambeck eine Reihe niedriger Ordensstufen, weil das Verleihungsland keine höheren kannte, wie z. B. die der österreichischen Bundesländer. Hier erhielt er von allen Ländern deren Auszeichnungen. Von der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände erhielt er die Opilo-Rossi-Medaille.
Schambeck zählte in und mit seiner Art zweifelsohne zu den profiliertesten Politikern Österreichs der zweiten Reihe im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Sein spezielles Auftreten war nicht immer jedermanns Sache, das manchmal auf Ablehnung stieß oder zu gelassenem Schmunzeln führte. Er war in jeder Hinsicht eine originelle Persönlichkeit, die teilweise wie aus der Zeit gefallen schien. Er war zweifelsohne auch ein Intellektueller von hohem Format sowie ein anerkannter Staatsrechtslehrer und Rechtsphilosoph, was er mit seiner politischen Tätigkeit in idealer Weise verbinden konnte. Sein Einsatz für die Kirche war anerkennenswert. Er lebte im Prinzip bescheiden und besaß kein Auto (weil er auch keinen Führerschein hatte). Im Gegensatz zu manchen in der politischen Klasse war er auf Geld nicht aus. Er repräsentierte in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht eine „Honoratioren-Republik“, die es so nicht mehr gibt, und legte Wert auf Form. Von ihm stammt der Spruch: „Formlosigkeit ist nichts anderes als eine etwas abgemilderte Form des Terrors.“
Schambeck ehelichte die Tochter Elisabeth des seinerzeitigen Landwirtschaftsministers und niederösterreichischen Landeshauptmanns Eduard Hartmann, die vor ihm starb. Er bezog kurz vor Weihnachten 2021 ein Pflegeheim in Wien-Döbling, empfing kaum noch Besucher und starb auch dort. Beim Requiem in der Stadtpfarrkirche von Baden hielt Bischof Egon Kapellari (Ca EM) die Predigt. Schambeck wurde auf dem dortigen Stadtpfarrfriedhof beigesetzt.
Schambeck war neben seinen Mitgliedschaften in insgesamt neun CV-Verbindungen noch Ehrenphilister der Wiener MKV-Verbindung Gral und der Katholischen Landsmannschaft Starhemberg Wien. Darüber hinaus war er noch Mitglied der Katholischen Studentenverbindung Pragensis in Prag sowie der Christlichen Studentenverbindungen Audacia Napocensis Klausenburg (Cluj, Rumänien) und Aquila Varadinensis Groß-Wardein (Nagyvarad, Oradea, Rumänien), die Mitglieder der freien Kurie des Europäischen Kartellverbands (EKV) sind.
Werke:
(Auswahl)Der Begriff der Natur als Sache (1964, Habilitationsschrift)
Kirche, Staat, Gesellschaft (1967).
Grundrechte und Sozialordnung (1969).
Das Volksbegehren (1971).
Prozesse sind ein Silberschweiß oder Juristen-Brevier (1979).
Pius XII. Friede durch Gerechtigkeit (Hg.; 1986).
Ethik und Staat (1986).
Kirche, Staat und Demokratie (1992).
Das österreichische Regierungssystem (1995).
Regierung und Kontrolle in Österreich (1997).
Politische und rechtliche Entwicklungstendenzen der europäischen Integration (2000).
Kirche, Politik und Recht (2013).
Gedanken aus der Zeit zur Zeit (2019).
Quellen und Literatur:
Aktenbestand der Ehrenzeichenkanzlei der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei (Kabinettsdirektor i. R. Heinz Hafner Am, Mitteilung 4. 10. 2023).https://www.parlament.gv.at/person/1590?selectedtab=BIO (Abruf 3. 10. 2023)
Kathpress 2. 10. 2023.
Mitteilungen von Heinz Hafner, 5. 10. 2023.
Hartmann, Gerhard: Die Ära Chaloupka im österreichischen CV, in: Für Volk und Glauben leben. Festschrift für Eduard Chaloupka. Hg. von Niolaus Drimmel. Wien 2002, 109–148,
Schambeck, Herbert: Eduard Chaloupka, ein engagierter Staatsbeamter und Katholik in einer Zeit des Aufbruchs, in: Für Volk und Glauben leben. Festschrift für Eduard Chaloupka. Hg. von Niolaus Drimmel. Wien 2002, 181–196 (hier über Schambeck als ÖCV-Amtsträger)