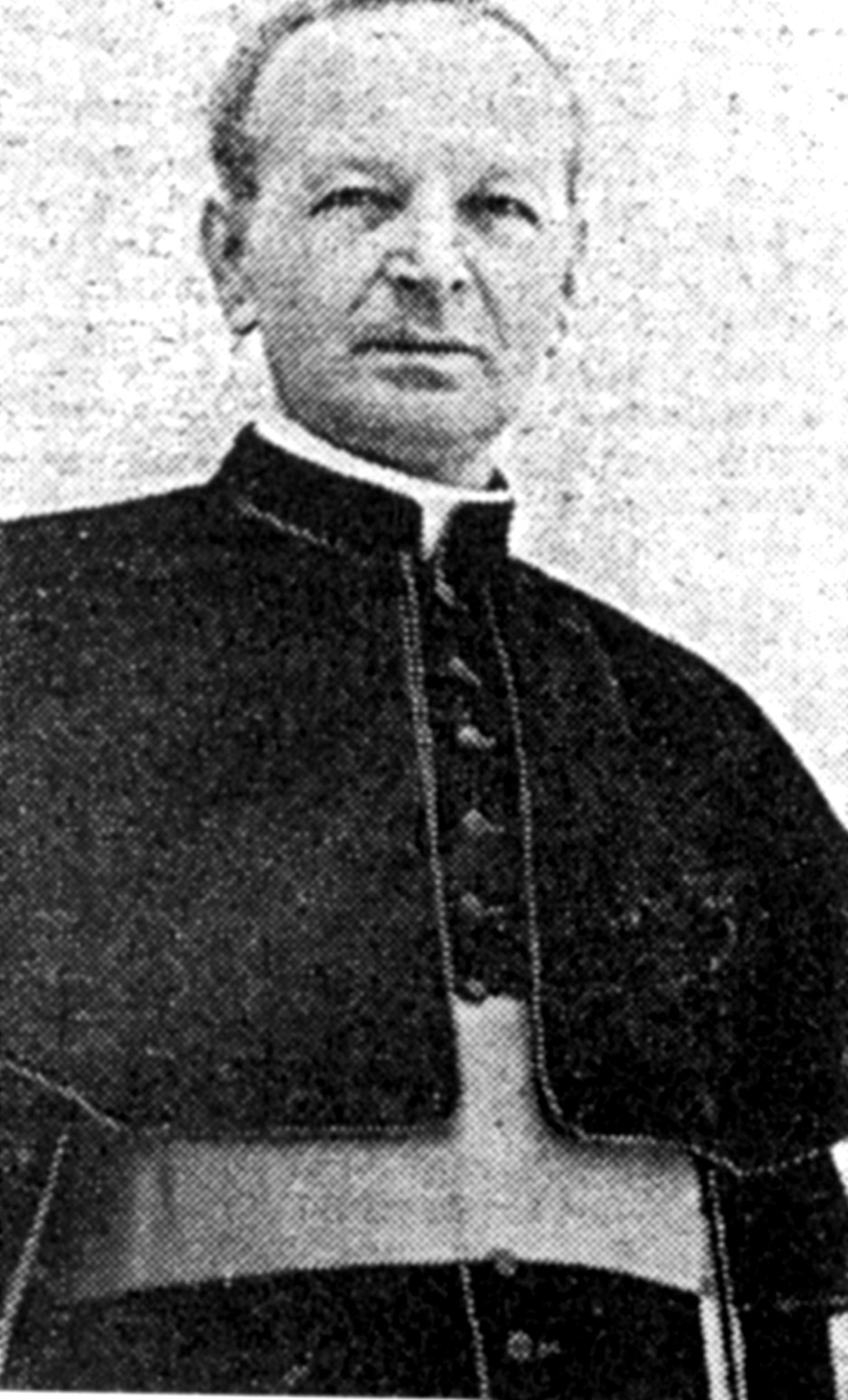Lebenslauf:
HERKUNFT UND AUSBILDUNG
Bugelnig wurde als Sohn eines Bergbauern (vulgo Edenbauer) geboren. Seine Pfarrgemeinde war St. Peter im Holz, eine Katastralgemeinde von Lendorf. Auf deren Gebiet liegen die Ausgrabungen der römischen Stadt Teurnia. In der Volksschule wurde er vom Ortspfarrer, der auch Religion unterrichtete, gefördert, so daß er nach der sechsten Klasse auf das Gymnasium in Klagenfurt wechselte und im Knabenseminar Marianum wohnte. Nach der Matura im Jahr 1913 trat er in das Klagenfurter Priesterseminar ein und begann das damals noch vierjährige Studium an der dortigen Philosophisch-Theologischen Hauslehranstalt (abs. theol. 1917).
Bereits nach drei Jahren Studium wurde Bugelnig am 18. Juni 1916 zum Priester geweiht. Was damals gelegentlich üblich war. Er durfte aber noch nicht Beichte hören, sondern war damals nur „Messeleser“. Das konnte er erst mit 1. Juli 1917, als er in die Seelsorge ging und die Beichterlaubnis bekommen hatte. In der Folge war er als Kaplan in St. Peter im Katschtal (Gemeinde Rennweg, Bezirk Spittal/Drau), in St. Jakob in Villach und in St. Veit an der Glan eingesetzt, wo Konrad Walcher (Rd EM) sein Pfarrer war. Dieser war von 1907 bis 1911 Reichsratsabgeordneter sowie bis 1921 Kärntner Landtagsabgeordneter und förderte seinen Kaplan Bugelnig.
Dieser konnte nun ab 1919 an der Wiener Katholisch-Theologischen Fakultät ein Doktoratsstudium absolvieren (Dr. theol. 1921), wo er im Frintaneum bei St. Augustin wohnte. Zusätzlich begann er das Studium der Staatswissenschaften an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (Dr. rer. pol. 1923). Möglicherweise von Konrad Walcher aufmerksam gemacht, trat er der Rudolfina bei (Couleurname Ivo). Im selben Jahr 1920 wurden auch der spätere Grazer Bischof Josef Schoiswohl (Rd), der spätere Verkehrsminister Ludwig Weiß (Rd) und der spätere ÖCV-Sekretär Theodor Lissy (Rd) rezipiert.
Bugelnigs Doktorvater war Othmar Spann, das Thema seiner Doktorarbeit lautete „Die Lohntheorie bei Thomas von Aquin“. Spahn war seit 1919 in Wien Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesellschaftslehre. Er vertrat einen universalistischen Korporatismus sowie eine Ständetheorie. Als solcher beeinflußte er die politische Rechte in Österreich und Deutschland sowie auch katholische Kreise, so auch nachhaltig Bugelnig, der mit Spann weiterhin persönlich verbunden blieb.
ZURÜCK IN KÄRNTEN IN DER POLITIK UND IN DEN MEDIEN
Nach seiner Promotion zum Dr. rer. pol. wechselte Bugelnig als Redakteur zur „Reichspost“, wo er von Friedrich Funder (Cl) eine fundierte journalistische Ausbildung erhielt. 1924 kehrte er nach Kärnten zurück und war im „Kärntner Tagblatt“ tätig, dessen Chefredakteur Michael Paulitsch (Rd) war. Dieses wurde vom St. Josefs-Verein, dem Katholischen Preßverein der Diözese Gurk, herausgegeben. Die Preßvereinsanstalten Kärntens waren unter dem Namen Carinthia zusammengefaßt – ähnlich wie die in der Steiermark bzw. in der Diözese Graz unter dem Namen Styria.
In den Jahren 1924 bis 1927 war Bugelnig Sekretär der Christlichsozialen Partei Kärntens, also Landesparteisekretär. Landesparteiobmann war zu dieser Zeit Franz Reinprecht (Rd), Spitzenvertreter der Christlichsozialen in der Landesregierung Landeshauptmannstellvertreter Sylvester Leer (Rd EM). Kärntner Landeshauptmann war damals der Landbundpolitiker und spätere Vizekanzler Vinzenz Schumy. Bei den Kärntner Landtagswahlen des Jahres 1923 gab es eine Einheitsliste von Landbund, Christlichsozialen und Großdeutschen, die 55 Prozent erhielt und den bisherigen sozialdemokratischen Landeshauptmann ablösen konnte. Innerhalb dieser Einheitsliste war der Landbund die stärkste Gruppe, daher stellte dieser mit Schumy den Landeshauptmann.
Nach seiner Tätigkeit als Landesparteisekretär wurde Bugelnig nach Niederösterreich geschickt, um dort das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen zu studieren. In der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer waren damals der spätere Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (F-B) und der spätere Landwirtschaftsminister sowie Genossenschaftspolitiker Ludwig Strobl (F-B) tätig. Zur selben Zeit wirkte Bugelnig auch als Religionslehrer an der Ackerbauschule in Tanzenberg. Jedenfalls gelang es ihm in Zusammenwirken mit Sylvester Leer und Vinzenz Schumy, daß 1936 die Allgemeine landwirtschaftliche Genossenschaftskasse mit dem Landesverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften Kärntens zusammengelegt werden konnten. Sein Engagement für das Genossenschaftswesen prägte Bugelnigs Ansichten zum Wesen eines Ständestaates wesentlich.
Nominell war Bugelnig nach seinem Studium in Wien und seiner Rückkehr im Jahr 1924 Domvikar in Klagenfurt. Von 1932 bis 1934 war er Studienpräfekt am Knabenseminar Marianum, wo er sicherlich unterfordert war. Daher übernahm er im Sommer 1934 als Generaldirektor die Leitung der Preßvereinsanstalten Carinthia. Unter diesem Dach wurde das „Kärntner Tagblatt“ und weitere Wochenzeitungen herausgegeben. Dann gab es einen Buchverlag sowie eine Buchhandlung und vor allem eine Druckerei, wo die Zeitungen und die Bücher hergestellt wurden. Zusätzlich war er ab 1934 Domprediger.
Der Gedanke, die Gesellschaft und den Staat nach ständischen Prinzipien zu organisieren bzw. aufzubauen, verließ Bugelnig nicht. Dabei versuchte er, die Vorstellungen des christlichen Sozialtheoretikers Karl Frhr. von Vogelsang (AW EM) mit denen von Othmar Spann in Einklang zu bringen. Als organisatorische Basis für seine Überlegungen diente ihm die Kärntner Sektion der 1892 gegründeten Leo-Gesellschaft. Deren Präsident war damals Franz X. Mayrhofer von Grünbühel (AW). Gemeinsam mit dem Kärntner Priester Rudolf Blüml wurde am 5. November 1931 im Rahmen der Leo-Gesellschaft eine Diskussionsrunde mit dem Namen „Die neue Gesellschaft“ ins Leben gerufen. Sie war bis März 1933 aktiv.
Diese Gesellschaft war „eine illustre Runde von katholischen, mit der ‚Ständestaat‘-Idee sympathisierenden Vordenkern“ (Werner Drobesch [Ca]). Bei den Mitgliedern des engeren Kreises dieser Runde „handelte es sich um Persönlichkeiten des intellektuellen katholischen Lebens in Kärnten“ (Klarissa Kristinus). Rund ein Drittel dieses engeren Kreises waren Angehörige des CV. Neben Bugelnig waren das noch Heinrich Gallhuber (Rd), der Gymnasialprofessor Karl Henhapel (NbW), der spätere Landesrat und nach Unterrichtsminister Felix Hurdes (NbW EM), die Rechtsanwälte Franz Ottitsch (Trn), Max Streit (Cl) und Ignaz Tschurtschenthaler (Trn), nach 1945 Nationalratsabgeordneter, sowie der Journalist Karl Zieger (S-B EM), ein enger Mitarbeiter von Paulitsch. Altbundeskanzler Ignaz Seipel (Nc EM) besuchte im Januar 1932 diesen Kreis.
AUSKLANG
Mit dem Anschluß endete Bugelnigs bisheriger Lebensweg abrupt. Kurz vor diesem gab es eine Krisensitzung beim damaligen Landeshauptmann, an der er in seiner Eigenschaft als Generaldirektor der Carinthia teilnahm. Es ging dabei um den Druck der Stimmzettel für die Volksabstimmung, die Bundeskanzler Kurt Schuschnigg (AIn) für den 13. März 1938 angesetzt hatte. Dabei stellte sich auch heraus, daß es keine brauchbaren Unterlagen für eine Wählerevidenz gab. Kein Wunder, denn die letzten Wahlen zum Nationalrat und zum Kärntner Landtag fanden 1930 statt. Jedenfalls wurde Bugelnig als Generaldirektor der Carinthia, die gleichgeschaltet wurde, abgesetzt und befand sich vom 11. bis 21. März 1938 in seiner Privatwohnung im Gebäude der Carinthia in Hausarrest, gleichsam in „Schutzhaft“, d. h., er durfte sie nicht verlassen.
Wie ging es dann mit Bugelnig weiter? Er wurde 1939 zum Stadtpfarrer von St. Lorenzen in Klagenfurt ernannt. Die Pfarre befindet sich östlich der Innenstadt auf der Völkermarkter Straße. Zum Pfarrgebiet gehören auch die Residenz des Bischofs sowie damals noch das Priesterseminar und die Philosophisch-Theologische Hochschule. Im Oktober 1945 wurde er gleich zum Chefredakteur des „Kärntner Kirchenblatts“ ernannt, welche Funktion er bis April 1950 ausübte. Darüber hinaus war er an der Rückerstattung der Preßvereinsanstalten beteiligt, deren Leitung er 1948 wieder vorläufig übernommen hatte.
Relativ spät, am 15. Januar 1953 mit 60 Jahren, wurde Bugelnig ins Domkapitel berufen. 1958 wurde er Richter am Bischöflichen Gericht und 1961 Temporalienverwalter des Domkapitels. 1961/62 war er vorübergehend Provisor der Dompfarre. Im Rahmen des Domkapitels rückte er 1965 in die Dignität eines Domscholasters und 1967 in die eines Domdechanten auf. Schließlich wurde er am 15. Oktober 1970 mit 77 Jahren Dompropst. (Über die Domkapitel-Dignitäten siehe ausführlich bei Franz Kirchner [Ca EM]). 1967 erhielt er auch den Titel eines Päpstlichen Hausprälaten.
Bugelnig war eine „Schlüsselfigur im Kärntner Verbandskatholizismus“ (Peter Tropper) und gehörte zur zweiten Reihe der christlichsozialen Politiker Kärntens der Zwischenkriegszeit sowie zur Reihe der dortigen Priesterpolitiker wie Konrad Walcher (Rd EM) und Michael Paulitsch (Rd). Er hatte zwar kein politisches Mandat inne, war aber deswegen nicht weniger einflußreich, vor allem wegen seiner Verbindung zum katholischen Medienbereich. Und er gehörte zum „Netzwerk“ der politisch Engagierten aus den Reihen der Rudolfina in Kärnten. Zu diesen zählten neben den genannten Walcher und Paulitsch auch Franz Reinprecht (Rd) und Sylvester Leer (Rd EM). Aber auch die noch vor 1938 Rezipierten aber erst nach 1945 politisch Tätigen Josef Klaus (Rd), Ludwig Weiß (Rd) und Leopold Guggenberger (Rd) sind dazuzurechnen.
Gegenwärtigen Generationen ist allerdings nur mehr schwer Bugelnigs Vorliebe für einen ständischen Aufbau der Gesellschaft vermittelbar. Dieser gründete vornehmlich auf Othmar Spann, seinem Lehrer in Volkswirtschaftslehre in Wien, der damals einen großen Einfluß auf (katholisch-)konservative bzw. junge Kreise ausübte. Bugelnigs diesbezügliche Ideen fußen sehr stark auf der Scholastischen Philosophie und haben nicht viel gemein mit dem tatsächlichen existierenden sog. „Ständestaat“ der Jahre 1934 bis 1938 in Österreich. Seine Ideen deshalb als „austrofaschistisch“ zu bezeichnen, werden der Sache nicht gerecht.
Bugelnig wurde auf dem Pfarrfriedhof St. Stefan bei Finkenstein (Šteben-Bekštanj; Bezirk Villach-Land, Kärnten) begraben.
Werke:
Geld und Zins (1931).Der Ständestaat. Dessen Voraussetzung und Verwirklichung (1935).
Um Ehe und Familie. Gedanken der Familienerneuerung (1935).
Die soziale Frage und die soziale Antwort der Kirche (1950).
Quellen und Literatur:
Kristinus, Klarissa: Philipp Bugelnig und die „Neue Gesellschaft“ als Vordenker der „Ständestaat“-Idee (1931 bis 1933). Klagenfurt (Bachelor Arbeit) 2024.Tropper, Peter: 900 Jahre Gurker Domkapitel. 1123 bis 2023. Festschrift im Auftrag des Domkapitels. Klagenfurt 2023, 148f.
Burz, Ulfried: Philipp Bugelnig. Seelenhirte mit politischem Engagement zwischen den Zeiten (1993–1983), in: Faszinierende Gestalten der Kirche Österreichs. Band 11. Hg. von Jan Mikrut. Wien 2004, 143–162.
Für weitere Unterstützung wird Univ.-Prof. Werner Drobesch (Ca) gedankt.