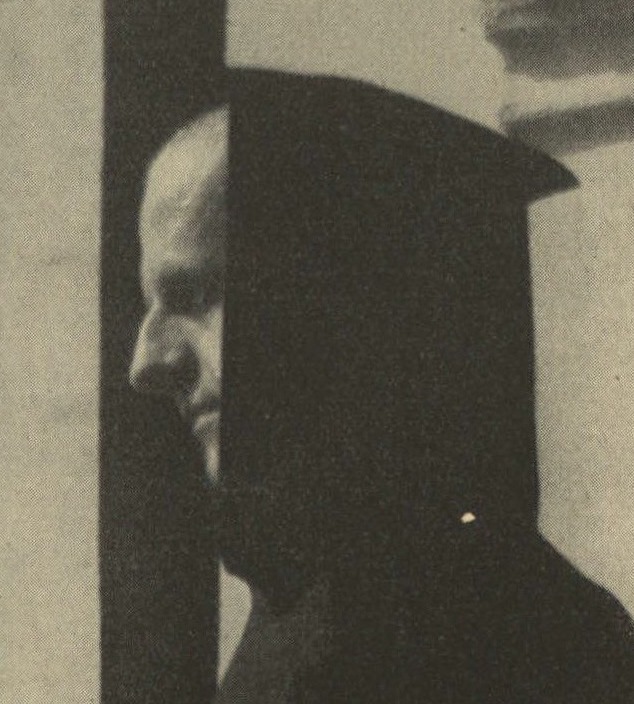Lebenslauf:
Liechtenstein wurde als jüngster Sohn des Aloys Prinz von und zu Liechtenstein sowie seiner Gemahlin Henriette, geb. Prinzessin von und Liechtenstein, geboren und auf die Namen Georg Hartmann Joseph Maria Matthias getauft. Sein älterer Bruder war der Vater des später regierenden Fürsten Franz Josef II. von und zu Liechtenstein.
Liechtenstein wuchs in Wien im Schloß Liechtenstein (9. Bezirk) auf. Nach dem im Hochadel üblichen privaten Unterricht (anstatt der Volksschule) ging er auf das Schottengymnasium, wo er 1899 die Matura ablegte. Danach beschloß er, in den Benediktinerorden einzutreten, und wählte dazu das Kloster Emaus (Emauzy) in Prag. Dieses wurde von Kaiser Karl IV. im 14. Jahrhundert gegründet und durchlebte eine wechselhafte Geschichte. 1880 wurden dort die aufgrund des Kulturkampfes ausgewiesenen Mönche aus dem Kloster Beuron aufgenommen, das damals in dem zu Preußen gehörenden Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen lag. Liechtenstein bekam den Ordensnamen Ildefons nach dem hl. Ildefons von Toledo (7. Jahrhundert).
Nach der einfachen Profeß Anfang 1901 begann Ildeofons sein Theologiestudium an der Benediktiner-Hochschule San Anselmo in Rom, das er 1906 beendete. Am 22. September 1906 wurde er in Prag zum Priester geweiht. Danach war er Religionslehrer an einer deutschen Schule in Prag und Religionsprofessor am Sacre Coeur in Prag-Smichov. 1912 wurde er zum Prior der Abtei Emaus gewählt. Anfang 1914 erkrankte er und befand sich zur Erholung eine zeitlang auf Schloß Hollenegg (Deutschlandsberg, Steiermark). Von dort wurde er auf den freigewordenen Lehrstuhl für Dogmatik an die Hochschule San Anselmo in Rom berufen, mußte jedoch diese Stelle im Mai 1915 nach der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn aufgeben.
Ildefons meldete sich dann als Militärseelsorger und war k. u. k. Feldkurat an der Tiroler Front. Nach dem Krieg wurden 1919 die deutschen Mönche aus Emaus ausgewiesen. Obwohl ihn das als liechtensteinischen Staatbürger nicht betraf, nahm er die Stelle eines Hausseelsorgers bei dem in diesem Jahr gegründeten Benediktinerinnenkloster St. Gabriel auf Schloß Bertholdstein in Pertlstein (damals Bezirk Feldbach, nunmehr Bezirk Südoststeiermark) an, welche er bis 1927 bekleidete. Danach kehrte er – bereits leidend – nach Emaus zurück. Jedoch verschlechterte sich seine Gesundheit zunehmend, so daß ihm erlaubt wurde, auf Schloß Frauenthal in Deutschlandsberg bei seiner Familie Aufenthalt zu nehmen, wo er dann auch starb.
Ildefons wurde auf dem Friedhof in Prag-Vyšehrad begraben, wo u. a. auch Antonin Dvorak, Friedrich Smetana und Rafael Kubelik liegen.